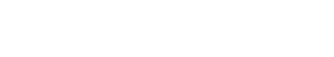Historie – Elisabeth von Canstein in Sippenhaft

„Am 1. Juni 1932 heiratete Elisabeth Freiin von Wendt, Tochter des Conrad Freiherrn von Wendt-Papenhausen zu Gevelinghausen und seiner Gemahlin Agnes, geborene Gräfin von Galen, den Diplomlandwirt Dr. agr. Werner Freiherr von Canstein. Die Trauung in der Schlosskapelle zu Gevelinghausen vollzog ihr Onkel Clemens August Graf von Galen. Dieser war damals noch Pfarrer von St. Lamberti in Münster ²). Nach der Hochzeit folgte Elisabeth von Canstein ihrem Gatten nach Ewig bei Attendorn. Er hatte dort das ca. 125 ha große ehemalige Klostergut, das, 1803 säkularisiert, nach dem Wiener Kongress in preußischen Staatsbesitz übergegangen war, von 1819-1898 in Privatbesitz sich befand und dann vom Lande Preußen zurückgekauft wurde ³), seit 1927 gepachtet.
Umzug nach Bigge im Jahr 1939
Infolge der geplanten Errichtung der Biggetalsperre drohte die Aufhebung der Domäne Ewig, so dass sich Werner von Canstein, Ulanenleutnant im Ersten Weltkrieg, etwa 1937 bei der Wehrmacht reaktivieren ließ, die Pachtung jedoch bis zum 1. Juli 1939 vertragsgemäß behielt. Um seine Abfindung wertbeständig anzulegen, kaufte er ein ca. 90 ha großes Gut in Grießen, Kreis Hameln, das heute im Besitz seiner Tochter Agatha ist. Elisabeth von Canstein zog mit ihren Kindern am 1. September 1939 von Ewig nach Schloss Schellenstein in Bigge/Ruhr um. Ihr Ehemann war bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zunächst beim Wehrmeldeamt Lippstadt, dann in Frankreich, anschließend beim Heerespersonalamt Berlin und schließlich beim Stab der XVI. Panzerdivision des Generals Hans Hube, wo er 1943 als Oberstleutnant in Stalingrad in russische Gefangenschaft geriet.
Canstein schließt sich dem „Bund Deutscher Offiziere“ an
Von 284 000 Deutschen Soldaten, die bei Stalingrad eingekesselt waren, wurden ca. 90 000 gefangengenommen. Davon sahen insgesamt 6 000 ihre Heimat wieder 4). Hitler hatte in der Katastrophe von Stalingrad bewiesen, dass ihm das Leben Hunderttausender von Soldaten wenig bedeutete. In der Überzeugung, dass seine verantwortungslose Führung nicht nur die rechtlichen Normen, sondern auch die sittlichen verletze und die gesamte deutsche Nation im Chaos ende, wurde am 11./12. September 1943 in Lunjowo bei Moskau der „Bund Deutscher Offiziere“ (BDO) gegründet. Diese Vereinigung mit bürgerlich-traditionellen Wertvorstellungen war dem kommunistisch beherrschten „Nationalkomitee Freies Deutschland“ (Walter Ulbricht u. a.) angegliedert und versuchte unter sowjetischer Aufsicht an der Beendigung des Krieges und der Beseitigung Hitlers mitzuarbeiten 5). Dem BDO, unter Führung des Generals Walther von Seydlitz-Kurzbach, dem auch Generalfeldmarschall Friedrich Paulus nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 beitrat, hatte sich Werner von Canstein angeschlossen.
Besuch auf Schloss Schellenstein
Im Herbst 1943 erhielt Elisabeth von Canstein auf Schloss Schellenstein überraschend Besuch von einem ehemaligen Nachbarn aus Ewig, einem Eisenbahner, den sie gut kannte, da dessen Tochter längere Zeit bei ihr als Haushaltshilfe tätig war. Er berichtete, er habe in einem russischen Sender einen Vortrag gehört über religiöse Fragen, den ihr Mann gehalten habe. Zweifelsfrei habe er seine Stimme wiedererkannt. Dies war die erste Nachricht seit langer Zeit, dass ihr Mann noch am Leben war. Diese Information musste streng geheim behandelt werden, da das Abhören feindlicher Sender mit Todesstrafe bedroht war. Selbstverständlich hatte der deutsche Abwehrdienst diesen Vortrag, den Werner von Canstein über das Thema „Religiöse Fragen in einem neuen, demokratischen Deutschland“ vor Mitgefangenen gehalten hatte, mitgeschnitten.
Am 26. April 1944 wurde General von Seydlitz vom Reichskriegsgericht wegen Kriegs- und Hochverrats in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Die Angehörigen der Mitglieder des ? Nationalkomitees Freies Deutschland? und des BDO waren von der Gestapo bedroht. Nicht nur Ehefrauen, die ihr Los durch Scheidung mildern konnten, auch Kinder und Verwandte mussten in Gefängnissen oder Konzentrationslagern haften.6) Am 5. Februar 1945 lautete schließlich ein Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht aufgrund der „Weisungen des Führers“: „Für Wehrmachtsangehörige, die in der Kriegsgefangenschaft Landesverrat begehen und deswegen rechtskräftig verurteilt werden, haftet die Sippe mit Vermögen, Freiheit oder Leben. Den Umfang der Sippenhaftung in Einzelfalle bestimmt der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei…“ 7)
Gestapo verhaftet Cousine von Elisabeth von Canstein
Auf der Suche nach Elisabeth von Canstein hatte die Gestapo etwa im September 1944 ihre Kusine Magdalena von Canstein, geborene Gräfin von Galen, verhaftet, deren Ehemann Chefarzt am Marienhospital in Siegen war. Sie hatte sich schon einmal bei den Machthabern unbeliebt gemacht, in dem sie den Reichspropagandaminister Goebbels in einem Brief gebeten hatte, von einer Ansprache in Siegen Abstand zu nehmen, da erfahrungsgemäß Städte, in denen er öffentlich gesprochen hatte, bald darauf bombardiert würden. Sie kam in das Gestapogefängnis nach Herne, wurde jedoch nach drei Wochen wieder entlassen. Die Vermutung, dass ihre Verhaftung aufgrund einer Verwechselung mit Elisabeth von Canstein erfolgt war, ist fragwürdig. Durch diese Festnahme in Schrecken versetzt, fürchtete man auf Schloss Gevelinghausen und Schellenstein, dass hier die Gestapo bald anklopfen werde, doch erschien sie erst Ende Januar 1945. Die Verhaftung seiner Tochter Elisabeth mitzuerleben blieb Conrad von Wendt durch seinen Tod am 19. Januar 1945 erspart. Als Elisabeth von Canstein und ihre Schwester Maria von Wendt am 31. Januar 1945 auf Schloss Gevelinghausen den Nachlass ihres Vaters ordneten, erschien unerwartet ein Gestapobeamter. Er hatte zunächst auf Schloss Schellenstein nach ihr gefragt und erfahren, dass sie in Gevelinghausen sei. Mit Hinweis auf den Vortrag ihres Mannes im sowjetischen Rundfunk verhaftete er sie und brachte sie nach Meschede in eine der Zellen, die als Untersuchungsgefängnis an das Amtsgerichtsgebäude angebaut waren. Die Zellen waren nicht mit Kriminellen belegt.
Maria von Wendt erinnert sich an einen ehemaligen Zentrumsabgeordneten des Provinziallandtages. Dann an einen Mann, der Feindsender abgehört und einen weiteren, der einen Kriegsgefangenen mit Zigaretten für geleistete Arbeit entlohnt hatte. Elisabeth von Canstein musste zunächst eine Zelle mit zwei weiteren Frauen teilen, erhielt jedoch dann eine Einzelzelle. Die Behandlung war korrekt, die Verpflegung dürftig. Täglich hatten die Gefangenen eine halbe Stunde Hofgang. Am 1. Februar 1945 besuchte Maria von Wendt ihre Schwester im Gefängnis und brachte ihr Lebensmittel und einige Habseligkeiten. Sie durfte generell Besuch empfangen und ihre Kinder sehen.
Verhör bei der Gestapo in Meschede
Am Nachmittag des 2. Februar 1945 verhörte sie der Gestapobeamte, der sie in Gevelinghausen abgeholt hatte, im Gestapobüro des Mescheder Rathauses. Die Vernehmung dauerte 2 ½ Stunden. Nach Fragen zu ihrer politischen Einstellung vor und während des „Dritten Reiches“ kam die Sprache auf den Vortrag ihres Ehemannes im russischen Sender. Ebenso wurde mehrfach auf ihren Onkel, den Bischof von Münster, angespielt, so dass sie den Eindruck gewann, man wolle auch ihn mit ihrer Verhaftung treffen. Als sie nach der Vernehmung das Protokoll unterschreiben sollte, weigerte sie sich. Sie sei zu erschöpft, um sorgfältig den Text noch einmal durchzulesen. Der Gestapobeamte war widerstrebend damit einverstanden und bemerkte u.a.: ?Länger als 14 Tage kann das Ganze ja nicht mehr dauern, dann bricht alles zusammen. Wir waren eben doch nicht die starke Volksgemeinschaft, die notwendig gewesen wäre, um gegen die ganze Welt anzutreten.? Als die Protokollführerin sie nach der Vernehmung in die Zelle zurückführen wollte, bat sie, an der Abendmesse in der Mescheder Stiftskirche teilnehmen zu dürfen. Darauf sagte der Gestapomann: „Das ist nicht erlaubt, aber ich habe nichts dagegen.“ Als sie an der Stiftskirche ankamen, war die Messe gerade zu Ende. Frau von Canstein ging zu dem ihr bekannten Vikar Risse in die Sakristei, informierte ihn kurz und bat ihn, ihr die Kommunion zu reichen, während ihre Bewacherin in der Kirche wartete.
Tieffliegerangriff auf Meschede
Vikar Risse hat sie etwa acht Tage später nochmals im Gefängnis besucht und ihr die Kommunion gebracht. Während ihres Gefängnisaufenthaltes gab es fast ständig Fliegeralarm, hauptsächlich wegen der Tiefflieger. Am 8. Februar 1945 erlitt Meschede einen größeren Tieffliegerangriff, bei dem 17 Männer, Frauen und Kinder starben 8). Die Gefangenen mussten während dieses Angriffs in ihren Zellen bleiben. Ebenso erging es ihnen bei dem schwersten Bombenangriff auf Meschede am 19. Februar 1945 gegen 14.30 Uhr, bei dem durch 150 schwere Sprengbomben, 250 Phosphorkanister und 20 000 Brandbomben mehr als 300 Häuser zerstört und 45 Menschen getötet wurden. Die Stiftskirche, das Rathaus, die Schützenhalle, das Altersheim, die Gräflich von Westpahlen“sche Zentralverwaltung u. a. wurden zerstört oder schwer getroffen 9). Auch in der Nähe des Amtsgerichts gab es Zerstörungen und Brände.
Welche Todesängste die Gefangenen in ihren Zellen dabei ausgestanden haben, kann man nur ahnen. Einige Tage später wurde Frau von Canstein im Gefängnis von der Frau ihres ältesten Schwagers, der Regierungsrat in Berlin war, besucht. Sie war von Berlin geflüchtet und in Schloss Schellenstein untergekommen. Als sie grade das Amtsgericht betrat, heulten die Sirenen Voralarm. Da man keine Vorkehrungen traf , die Gefangenen in den Keller zu lassen, lief sie laut protestierend auf die Straße und bat die Passanten um Hilfe. Ihre Zivilcourage hatte Erfolg. Seit diesem Tag durften die Gefangenen bei Alarm in den Amtsgerichtskeller.
Bombenangriff trifft Mescheder Amtsgericht – Haftzellen unbrauchbar
Die Opfer des Bombenangriffs vom 19. Februar 1945 waren erst wenige Tage auf dem Mescheder Friedhof bestattet, als am 28. Februar gegen 15 Uhr erneut ein Bombenhagel auf Meschede niederging, bei dem hauptsächlich die Honselwerke, einige Schulen und auch das Amtsgericht getroffen wurden 10). Die Haftzellen waren nun unbrauchbar. Frau von Canstein hatte mit den übrigen Gefangenen den Angriff im Amtsgerichtskeller überlebt. Nach Beendigung des Angriffs erklärte sie dem Gefangenenaufseher Leimbach, sie gehe jetzt nach Hause, da sie ja nicht mehr in Haft gehalten werden könne. Leimbach: „Das kann ich nicht erlauben.“ Frau von Canstein: „Das brauchen sie auch nicht. Ich sage es Ihnen nur, damit sie mich nicht unter den Trümmern suchen.“
Mit letzter Kraft bahnte sie sich den Weg durch Schutt und Asche, vorbei an brennenden Häusern und Bombentrichtern in Richtung Gevelinghausen. In Wehrstapel musste sie noch einmal wegen Fliegeralarm einen Keller aufsuchen. Auf der Straße nach Velmede traf sie Heinrich Kussmann, den landwirtschaftlichen Verwalter des väterlichen Rittergutes, der mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Meschede war, um sie zu suchen. Er telefonierte sofort von Velmede aus nach Gevelinghausen und forderte einen Pferdewagen an. In Ostwig nahm sie der Kutscher auf. Nach einigen Tagen auf Schloss Gevelinghausen kehrte Elisabeth von Canstein in ihre Wohnung auf Schloss Schellenstein zurück. Von der örtlichen Polizei war ihr durch Dritte angedeutet worden, man werde sie erneut verhaften.
Am Abend des 27. März 1945 stand ein Mann vor der Schlosstür von Schellenstein, um sie abzuholen. Man konnte sie unauffällig warnen, so dass ihr die Flucht über eine Hintertreppe durch einen Seitenausgang im Schutz der Dunkelheit nach Gevelinghausen gelang. Dem Mann mit dem Haftbefehl teilte man mit, sie sei krank und befände sich in Gevelinghausen. Am Gründonnerstag, dem 29. März 1945, traf die Nachricht ein, amerikanische Panzerspitzen seien bis Winterberg vorgestoßen.
Zuflucht in Wiggeringhausen
Da man sie nun auch bald in Olsberg und Bigge erwartete verbrannten die Parteifunktionäre ihre Akten und suchten ihr Heil in der Flucht. In dieser chaotischen Situation rieten gute Freunde Frau von Canstein dringend einen Zufluchtsort zu suchen. Zwei Jagdhütten, die man wahlweise in Aussicht genommen hatte, erwiesen sich für einen zeitlich unbestimmten Aufenthalt als unzweckmäßig. Außerdem waren sie wegen der zahlreichen „Fremdarbeiter“, die infolge der Bombenangriffe und der Stillegung von Fabriken sich selbst überlassen und unversorgt in den Wäldern umherirrten, zu unsicher. So entschied man sich für das Forsthaus Wiggeringhausen, wohin sie sich am 29. März 1945 im Dunkeln begab und von der Familie des Forstverwalters Josef Nieland fürsorglich betreut wurde.
Auf Dauer schien das Forsthaus Wiggeringhausen im Elpetal nicht sicher genug. Vor allem aber wollte Elisabeth von Canstein wieder bei ihren Töchtern- damals 12, 7 bzw. 4 Jahre alt – sein. So nahm sie dankbar das Hilfsangebot des Barons Hermann-Josef von Fürstenberg zu Körtlinghausen bei Kallenhardt an. Das Auto auf Schloss Gevelinghausen war zwar stillgelegt, doch noch fahrbereit. Eine Notreserve an Kraftstoff war auch vorhanden. Ein in Gevelinghausen einquartierter Major, den man in den Fluchtplan eingeweiht hatte, konnte ermitteln, dass die Straße Nuttlar-Kallenhardt noch passierbar sei. Unter strikter Geheimhaltung lenkte der Cheffahrer Anton Happel den Opel in der Nacht zu Karsamstag (31. März) nach Körtlinghausen, wo sie und ihre Kinder freundlich aufgenommen wurden.
Bigge wird mit Artillerie beschossen, Gestapo erscheint auf Schellenstein
Gefahrvolle Situationen entstanden nochmals bei der Besetzung Körtlinghausens durch die Amerikaner. Dass die Flucht nach Körtlinghausen eine kluge Vorsichtsmaßnahme war, erwies sich wenige Tage später. Als am 3. April 1945 die amerikanische Artillerie bereits Bigge beschoss, erschien erneut ein Gestapomann auf Schloss Schellenstein, um Frau von Canstein zu verhaften. Hätte er seinen Auftrag ausführen können, wären die Folgen unabsehbar gewesen. Nach der Besetzung Bigges am 6. April und Gevelinghausens am 7. April 1945 holte sie sich in der folgenden Woche Pferd und Wagen in Gevelinghausen, um ihre Kinder und ihr Gepäck nach Schellenstein zurückzutransportieren. Im Frühjahr 1949 zog sie mit ihren Kindern auf ihr Gut nach Grießen um. Wenige Monate später kehrte ihr Gatte aus russischer Gefangenschaft zurück.
Kapelle nach glücklicher Heimkehr gebaut
In Russland hatte er gelobt, im Falle glücklicher Heimkehr eine Kapelle zu bauen. Er hielt sein Gelöbnis. Die Kapelle schmückt eine Statue der Hl. Agatha, die die Gemeinde Gevelinghausen dem Ehepaar von Canstein, das sich in Gevelinghausen großer Sympathie erfreute, zur Hochzeit geschenkt hatte. Hinter dem Altar hängt ein großes Kreuz, das aus einer Eiche aus dem Schlosspark angefertigt wurde. 1950 beauftragte Werner von Canstein die Bildhauerin Christel Nieland, Tochter des Forstverwalters Josef Nieland, ein Tonrelief der „Madonna von Stalingrad“ zu modellieren. Als Vorlage diente eine Kopie der Zeichnung, die der Oberarzt Dr. Kurt Reuber am Heiligen Abend im Kessel von Stalingrad auf der Rückseite eine Landkarte von Russland gezeichnet hatte. Die Zeichnung stellt eine Madonna dar, die unter dem schützenden Mantel das Christkind behütet. Das Original der Zeichnung hängt heute in der Gedächtniskirche in Berlin. Reuber starb 1946 in russischer Gefangenschaft. Das Relief „Die Madonna von Stalingrad“ ist an der Stirnseite der „Stalingrad-Kapelle“ in Grießem eingelassen. Die Kapelle weihte 1954 ein Geistlicher, mit dem Werner von Canstein in der Gefangenschaft befreundet war.
1) Nach Aufzeichnungen von Maria Freiin von Wendt, soweit nicht andere Quellen angegeben.
2) Bischof der Diözese Münster wurde er im September 1933.
3) F. Ackermann/A. Bruns, Burger, Schlösser und Klöster im Sauerland, Arnsberg 1985
4) Brockhaus
5) Scheurig, Bodo, Freies Deutschland. Das Nationalkomitee und der Bund Deutscher Offiziere der Sowjetunion 1943-1945, München 1961
6) Ebda., S. 75.
7) Ebda., S. 204.
8) Huyskens, Albert, der Kreis Meschede unter der Feuerwalze des Zweiten Weltkrieges, Bielefeld 1949